

Rolf Thalmann (Hg.): "Keine Liebe ist an sich Tugend oder Laster."
Heinrich Hössli (1784–1864) und sein Kampf für die Männerliebe
Zürich: Chronos 2014, 224 S., 31 €
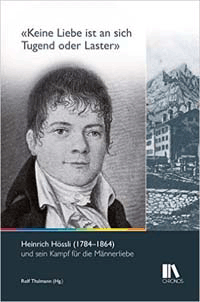
Rezension von Helmut Puff, Ann Arbor (Michigan)
Erschienen in Invertito 16 (2014)
Seit den1970er Jahren hat die Frage nach den Gründen für die "Geburt des Homosexuellen" die historische Forschung beschäftigt. Die Sozialhistorie hat seinen Ursprung im Milieu städtischer Subkulturen ausgemacht. Die Diskursgeschichte hat veränderten Denkweisen den Vorrang eingeräumt; demnach hätten neue Wissenschaften wie die Gerichtsmedizin Pate bei der Entstehung des Konzepts der Homosexualität als einer Existenzform gestanden. Die prägende Rolle des geschriebenen, publizierten und gelesenen Wortes für die Geschichte der Homosexualitäten wird demgegenüber immer wieder unterschätzt. Die langwährende historische Genese dessen, was man moderne sexuelle Identitäten nennt, ließe sich mit Fug und Recht als eine Geschichte des Lesens konzipieren. Nicht von ungefähr tauchen in einschlägigen Romanen des frühen 20. Jahrhunderts – etwa in Stephen Spenders The Temple (geschrieben in den 1930er Jahren, veröffentlicht 1988) oder in Radclyffe Halls The Well of Loneliness (1928) – Figuren auf, deren Lesen sexuelles Tun oder jedenfalls sexuelle Selbsterkenntnis zur Folge hat. Ob Lesende sich literarische, essayistische oder wissenschaftliche Texte aneignen, Lesen birgt generatives Potenzial in sich. Mehr noch, das Gelesene verbindet einzelne Leser und Leserinnen miteinander. Lesen ist für das Entstehen realer wie ideeller communities verantwortlich – über die Schranken von Raum und Zeit. Gerade die Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts mit ihren Bildungschancen, Lesegesellschaften und einem expandierenden Markt an Gedrucktem war ein guter Nährboden für das Lesen als Motor sozialen Wandels. Eines der vielen herausragenden Verdienste des vorliegenden Sammelbandes ist es denn auch, anhand eines epochalen Texts Schlaglichter auf die Rolle von Schrifttum bei der Entstehung sexueller Subjektivitäten zu werfen.
Heinrich Hösslis Eros. Die Männerliebe der Griechen; ihre Beziehungen zur Geschichte, Erziehung, Literatur und Gesetzgebung aller Zeiten, 1836/1838 in zwei Bänden auf nicht weniger als 721 paginierten Seiten erschienen, ist das erste gedruckte Manifest für den Eros von Männern als einer sexuellen Liebe, deren Existenzrecht gegen Verfolgung, Entrechtung und Ächtung behauptet wird. Von der außerordentlichen Schwierigkeit, eine solche Apologie zu verfassen (für die Hössli auf keine unmittelbaren Vorbilder zurückgreifen konnte), legt die Abhandlung mit ihrem sperrigen Umfang und ihren weitschweifigen Gedankengängen beredtes Zeugnis ab. Wie ein aus dem schweizerischen Glarus stammender Hutmacher sich zu einem Pionier sexueller Emanzipation entwickelte, ist eine Frage, zu deren Erhellung der vorliegende Band eine Reihe ausgezeichneter Antworten bereithält. Er wird sich als unverzichtbar für alle erweisen, die sich auf das Abenteuer einer Lektüre von Eros einlassen oder an der Geschichte des "Nathurrätsel[s] des Uranismus" (Karl Heinrich Ulrichs, 1870) interessiert sind.
Für die Frage nach der "Geburt der Homosexuellen" in der Historie stellt Hösslis Abhandlung einen faszinierenden Fall dar. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Hössli die Liebe, für deren Anerkennung er als Schriftsteller eintrat, auch praktiziert hat. Vielmehr führte er, soweit man weiß, ein unauffälliges Leben; er war verheiratet und Vater zweier Söhne. Der Autor des Eros nennt die Hinrichtung eines männerliebenden Mannes im Jahr 1817 – also fast zwanzig Jahre vor der Erstveröffentlichung – als Auslöser für seinen publizistischen Feldzug; eine Hinrichtung, die er im Übrigen nicht selbst erlebt, sondern von der er gelesen haben dürfte. Der Rezeption von Hösslis Lebenswerk standen indes erhebliche Hindernisse im Weg: Glarner Behörden ließen den ersten Band konfiszieren; der zweite Band musste in St. Gallen herausgebracht werden; ein dritter Band, den der Autor ankündigte, ist nicht mehr erschienen. Aufgrund einer relativ dürftigen Aktenlage bleibt auf absehbare Zeit das Rätsel dieses Texts das Hauptstück jeder Beschäftigung mit Hössli – und sein Verständnis bedeutet, wie die Beiträge in dem von Rolf Thalmann herausgegebenen Sammelband vorführen, eine Herausforderung. In erster Linie versammelt Keine Liebe ist an sich Tugend oder Laster daher auch Annäherungen an Hösslis ebenso bahnbrechenden wie enigmatischen Text und dessen Nachhall.
Der Reigen wird von Auszügen aus Ferdinand Karschs Essay eröffnet, der die Hössli-Forschung zuerst angestoßen hat. Nachdem er alle Nachrichten über Hössli, derer er habhaft werden konnte, gesammelt hatte, veröffentlichte er 1903 ein eindrückliches Lebensbild im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Seine umfassenden Forschungen zum Autor des Eros sind schon deswegen grundlegend, weil viele der von ihm benutzten Archivalien als verloren zu betrachten sind – ein Reflex der Brüche und Diskontinuitäten in der Geschichte männlicher Homosexueller.
In "Heinrich Hösslis Glarus" (S. 37-59) erhellt Rolf Kamm eindringlich den gesellschafts- wie bildungsgeschichtlichen Entstehungskontext von Eros. Im 19. Jahrhundert war Glarus demzufolge alles andere als Provinz. Vielmehr sahen einige zeitgenössische Beobachter in der Stadt geradezu eine Art Modell. Denn an diesem Ort traf der technische Fortschritt der maschinellen Textilproduktion auf die Errungenschaften einer traditionalen Gesellschaft; althergebrachte Strukturen politisch-sozialer Partizipation verbanden sich mit einem modernen Verfassungspatriotismus. Zugleich hatte die Spätaufklärung in der schnell wachsenden Stadt öffentliche Leihbibliotheken und Debattierklubs entstehen lassen. In einer durchaus schwierigen Balance zwischen Industrialisierung einerseits und Traditionalismus andererseits hatten die so genannten Stillstände, also kirchliche Institutionen, die Aufsicht über die öffentliche Moral inne. Und der Glarner Stillstand war es dann, der die Verbreitung von Eros verbot – ein Werk, das, folgt man Kamm, die Widersprüche des Orts seiner Entstehung, Glarus im 19. Jahrhundert, exemplarisch widerspiegelt.
Auszüge aus Rainer Guldins Studie von 1995 Lieber ist mir ein Bursch … Zur Sozialgeschichte der Homosexualität im Spiegel der Literatur werden auf den folgenden Seiten dankenswerterweise wieder abgedruckt (S. 61-70). Sie stellen der Leserschaft des Sammelbands eine bündige Übersicht über das Gesamtgebäude von Hösslis Argumentation vor Augen. In einem äußerst lesenswerten Beitrag beleuchtet Hans Krah Zentralbegriffe Hösslis aus der Perspektive historischer Bedeutungsforschung (",Eros‘ (1836/1838) – Textanalyse und historische Semantik", S. 71-95). Das ist deswegen unabdingbar, weil eine heutige Leserschaft unter Geschichte, Wissenschaft, Kunst, Natur und Menschheit etwas anderes verstehen wird als Hössli. Dessen Universalismus bedingt, wie Krah zeigt, eine selektive Argumentationsweise: Dabei steht ein besonderes Phänomen wie die Männerliebe in Relation zur ganzen Menschheit. Die einseitige Konzentration Hösslis auf die literarische Überlieferung angesichts der zu seinen Lebzeiten fortschreitenden Auffächerung medizinischen Spezialwissens musste jedoch Eros schon zum Zeitpunkt seiner Publikation obsolet erscheinen lassen. Krah spricht denn auch folgerichtig von der Rückwärtsgewandtheit des Texts bzw. Autors. Gegen den längst etablierten Historismus und Empirismus blieb er einem aufklärerischen Ganzheitsdenken verpflichtet, das die Natur- und Menschheitsgeschichte als Entfaltung der Menschennatur begreifen wollte, in der jedes Phänomen seinen Platz behaupten konnte.
Hösslis Antikerezeption ist das Thema von Sebastian Matzners "Homophilhellenismus" (S. 97-128). Die in der schulischen Erziehung und in verschiedenen Diskursen der Zeit fest verankerte Idee der Vorbildlichkeit der Antike lud dazu ein, sich aus dem Fundus des Vergangenen zu bedienen, um die eigene Subjektkonstitution voranzutreiben oder der Forderung nach gesellschaftlicher Anerkennung Gehör zu verschaffen – für den Verfasser ein gelungenes Beispiel einer "ostentativ-subversive[n] Antikerezeption" (S. 107), wie sie unter männlichen Homosexuellen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gut belegt ist (wobei die Ausstrahlung antiker Kunst stärker zu berücksichtigen wäre). Allerdings würden dann um die Jahrhundertwende mit der zunehmenden Auffächerung homosexueller Subjektivitäten vermehrt Brüche in der Antikerezeption homosexueller Männer sichtbar. Subversiv war diese ferne erotische Vergangenheit schon allein deshalb, weil viele Philologen und Professoren um das Thema des mannmännlichen Eros einen Bogen machten. Ihrer Strategie, die Texte ihrer sexuellen Referenzpunkte zu berauben, hat sich Hössli entgegengestellt, indem er auf dem sexuellen Charakter der Männerliebe in der Antike insistierte. Mit der Bezugnahme auf einen gesellschaftsfähigen Klassizismus lässt sich, wie der Verfasser vorschlägt, möglicherweise auch erklären, warum Hösslis Eros ohne eine Theorie der Homosexualität auskommen konnte.
In "Die Quellen der Innovation" (S. 129-149) macht Robert Deam Tobin Hösslis Modernität unter anderem darin aus, dass dieser die Männerliebe eindeutig sexuell definiert und den "Geschlechtstrieb" (S. 135) für einen unveränderlichen Bestandteil ihres Wesens hält. Diese Modernität wird fassbar, wenn der Verfasser Eros an der Schnittstelle verschiedener zeitgenössischer Diskurse verortet: von Freundschaft, Sexualität und Natur. Tobin gelingt es so, Eros in der Literatur, Philosophie und Wissenschaft des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zu kontextualisieren. Das ist schon deswegen überzeugend, weil Hössli die Emanzipation der Männerliebe mit der der Juden und Frauen vergleicht (auch wenn er das Pendant der "Frauenliebe" übersieht).
Für die oben angerissene Geschichte der Sexualitäten als einer Geschichte des Lesens muss die Ausbildung fester Textcorpora von besonderem Interesse sein. Schließlich signalisieren solche Zusammenstellungen Kontinuität in der Beschäftigung mit einem Thema wie der Männerliebe. Wegen der Vereinzelung der Protagonisten und der Zugriffe der Zensoren war die Ausbildung eines Kanons, der "geeignet" war, "die eigene Identität zu stützen" (S. 152), erheblich erschwert. Marita Keilson-Lauritz widmet ihren Beitrag genau diesem Aspekt, "Hösslis ,Stimmen und Zeugen‘" (S. 151-172). Insgesamt 42 Exzerpte sollen demnach die Normalität des mannmännlichen Eros unter Beweis stellen. Neben sekundär rezipierten Stellen aus der antiken Literatur schöpfte der Autodidakt aus Glarus vor allem aus publizierten Anthologien orientalischer Poesie (oft ohne wortgenau zu zitieren). Die herausragende Bedeutung Griechenlands als Garant für eine gesellschaftliche Akzeptanz der Männerliebe nahm im 20. Jahrhundert mit der Einsicht in die Inkommensurabilität eines intergenerationellen Eros mit der modernen Idee der Homosexualität als Verbindung Gleicher ab, so Keilson-Lauritz, ohne ganz zu verschwinden.
Manfred Herzer thematisiert Hössli als Rezipienten der von ihm ausgiebig benutzten Autoren ("Drei Hössli-Studien. Knabenschändung – Johann Gottfried Herder – Platonismus", S. 173-194). Dabei spricht er zu Recht von der von Hössli "missverstandenen deutschen Aufklärungsphilosophie" (S. 173). Überhaupt fokussiert der Verfasser die Spannungen im Text mit seinen Anspielungen, Widersprüchen, gelegentlichen ironisch-humorvollen Brechungen und Auslassungen. Die Frage beispielsweise, ob die griechische Knabenliebe eine "sittliche" Institution war und daher in der Moderne zu restituieren sei, habe Hössli ebenso wenig entschieden, wie er sich mit der eventuellen "weibische[n] Mannheit" des männerliebenden Manns und dessen Sexualleben schwer getan habe.
In zwei abschließenden Kurzbeiträgen hat der Herausgeber Rolf Thalmann Belege zum Echo von Hösslis Eros in der Schweiz zusammengestellt. Dazu gehören Zeugnisse aus kulturgeschichtlichen Abhandlungen sowie aus Protokollen bzw. Veröffentlichungen der Homophilenbewegung, die regelmäßig an "ihren Vorkämpfer" erinnerte ("Streiflichter auf Hösslis Nachleben in der Schweiz", S. 195-200). In einem Ansatz, von dem man hofft, dass er Schule macht, hat er außerdem die in Bibliotheken nachweisbaren Druckausgaben von Eros – darunter auch die Neuausgaben von 1892 und 1924 – konsultiert, aufgelistet sowie auf Provenienzen hin untersucht ("Die Ausgaben von Heinrich Hösslis ,Eros‘", S. 201-214). Die Tatsache, dass Hösslis Eros nunmehr einer interessierten Leserschaft als Teil des digitalisierten Bestands der Österreichischen Nationalbibliothek sowie der Staatsbibliothek zu Berlin zur Verfügung steht (überprüft am 23.12.2014), bedeutet, so kann man hoffen, den Beginn eines neuen Kapitels in der Rezeptionsgeschichte von Eros.
Ein "Chronologisches Verzeichnis der Literatur zu Heinrich Hössli" (S. 215-218) und ein Namensregister runden den Band ab. Keine Liebe ist an sich Tugend oder Laster weist des Weiteren zahlreiche Abbildungen auf: Porträts des Autors, Ansichten von Glarus sowie Reproduktionen der Titelblätter von den Ausgaben seines Lebenswerks.
Ein Gesamtbild des disparaten Texts von Eros und seines autodidaktischen Autors ergibt sich dabei trotz der Vielfalt der Annäherungen nicht. Dem Sammelband über den Pionier haftet etwas Pionierhaftes an. Das janusgesichtige Profil dieses eigenwilligen Lesers, Denkers und Autors – sein Changieren zwischen Konzision und Weitschweifigkeit ebenso wie seine progressive Grundhaltung aus zum Teil veralteten Quellen – deutlich sichtbar gemacht zu haben, ist allerdings eine außerordentliche Leistung. Dass eine Institution wie die Heinrich Hössli Stiftung, deren Präsident Franco Battel den Band mit einem pfiffigen Grußwort eröffnet, die Publikation von Keine Liebe ist an sich Tugend oder Laster neben anderen Stiftungen mitfinanziert hat, lässt hoffen, dass Hössli endlich einer weiteren Öffentlichkeit bekannt wird – eine längst überfällige historische Wiedergutmachung, die hoffentlich weitere Forschungen nach sich ziehen wird.
